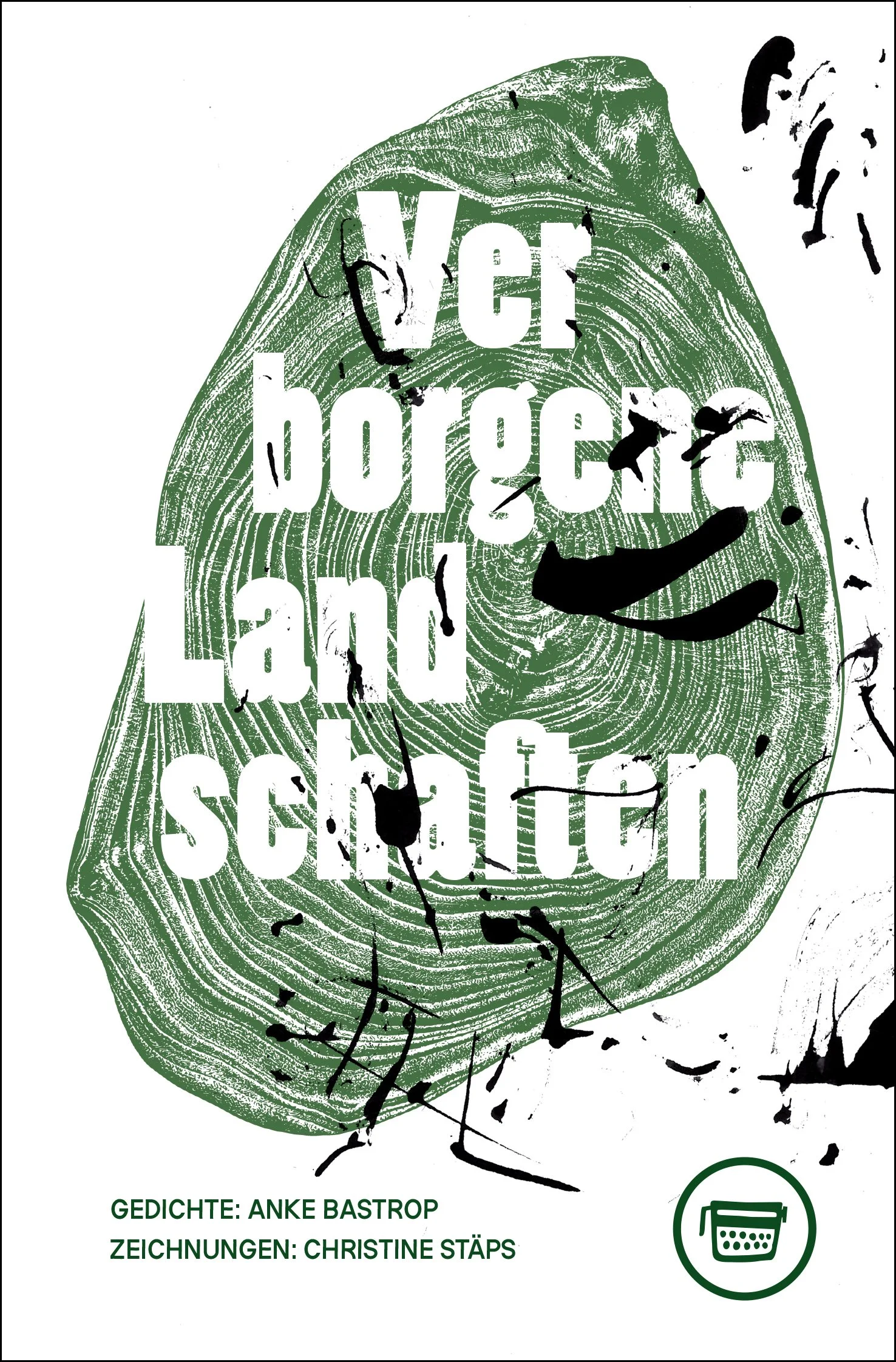Wer den Meister anruft. Mit den Zeitgedichten Richard Doves
Und um uns ward’s Elysium. [FGK, 1753.]
Nun ja, Spott und Herablassung waren lange genug um Friedrich Gottlieb Klopstock (1724–1803), den Meister des Messias, vor allem aber durch die Zeiten brechender und für die Nachfolgenden Maßstäbe setzender Oden in überkommenen wie selbstgefundenen Maßen, der einer der ersten freien Dichter der Neuzeit sein durfte, dank der Gunst eines guten Königs, der ihn schreiben und gewähren ließ. Zu groß waren wohl die Gloriolen derer, die ihm nachfolgten (und sich allesamt auf ihn beriefen): Goethe, Schiller, Hölderlin und Novalis, um nur die Großen zu nennen. Und doch ist es so, dass ohne die Vorarbeit FGKs, die Aufbereitung der antiken, quantitierenden Metren, ihre Transformation in die eigene, akzentuierende Sprache, die deutschsprachige Dichtung der Neuzeit bis zur Gegenwart eine andere wäre. Ärmer, wenn man an die völlig freie und somit ungeheuerliche Liebes-Lyrik Klopstocks für seine Cidli denkt oder den brüderlich-respektablen Umgang mit Gott, auf jeden Fall. Immerhin war 2024, ganz ähnlich wie bei Kant, ein ausgewiesenes Klopstock-Jahr.
Interessant, by the way, dass auch Richard Dove, den es zu würdigen gilt in diesem Text, eine ähnliche Transformation vollzieht, indem er aus einer funktionalen wie poetischen Sprache zugleich ins Deutsche wechselte und so zu einem deutschen Dichter geworden ist, dem der Tellerrand keinen Schrecken einjagt. Im Gegenteil: Die Anverwandlung von Mutter- und erworbener Sprache zeitigt eine Offenheit in der Sprache einerseits wie auch in der Wahl der Themen und Orte. Mithin gute Argumente, in den lichten Zeitkeller der Hochliteratur hinab- wie auf die wackligen Windtürme des im besten Sinne Künftigen hinaufzusteigen. „Gesprächsanbahnungen“ nennt man Doves Art, der Zeit ins Geweid zu greifen, Epiphanien der Gegenwart, die über die Jahrhunderte hin sprechen und so die Tradition, die Weltläufigkeit der gewählten Orte und Chakren und das unmittelbar Anstehende in eins nehmen und zu einem Gewebe formen, das so einzigartig postulierend wie eben auch hinterfragend erscheint. Ob man am Ende Klopstock an die Strippe, in den Äther bekommt, ist nicht gewiss – aber der Gedanke daran zählt wie auch der Versuch, sich das vorzustellen. So wie es FGK anstand, von, ja, und mit Gott zu sprechen.
Hatte der aus dem südwestenglischen Bath, der Stadt der Minerva Sulis, die schon – in dieser Reihenfolge – Kelten und Römer faszinierte, stammende studierte Germanist zunächst auf Englisch geschrieben und war in seiner neuen Heimat auf Übertragende angewiesen, so gebraucht Richard Dove nun das Werkzeug der neuen, der Nicht-Muttersprache, in Bei Anruf Klopstock souverän, unerschrocken. Der Ton dieser Texte changiert vom Althergebrachten und auch durchaus Exotischen (das Ghasel etwa, Dove gilt als Rückert-Spezialist) bis zum Experimentellen und Bruchstückhaften. In gewisser Hinsicht vollzog auch der große Altvordere diese Suchbewegung und bewegte sich mal sicher, zuweilen irrte und verfitzte er sich auch, aber führte die Hingabe an die Möglichkeiten des Sprechens und nicht zuletzt Anverwandelns mustergültig vor: Als ein Muster, das bis heute für das Ideal dessen steht, wie man eine Existenz als Denker und Schreiber zu führen habe. „Anruf“ vielleicht auch aus diesem Grund, dass man dem Vorausgänger Zeugnis geben will und Bericht erstatten, wie weit es mit diesen künstlerischen Tugenden sei und was denn heute dagegensteht, wenn es damit (und den Weltläuften) Schwierigkeiten gibt …
Die Weltläufte, natürlich. Sie provozieren Zeitgedichte, wie es im Untertitel des 115 Seiten und sieben Zyklen, „Anbahnungen“, fassenden Buchs heißt. Und da war, wie es sich nun zeigt, mit der Corona-Krise noch nicht der hohe Grad der Beschissenheit erreicht. Im ersten Kapitel des Buchs geht es um ebenjene Isolation, die der Virenausbruch über die Menschen brachte – Dove ergeht sich etwa in Marsyas-Visionen: Alles, was berührt wird, ist kontaminiert; und der Sprecher der Texte träumt sich aus seinem modernden Keller der Eingesperrtheit in den Frühling, der auch noch mit Süden betan ist. Das wird in einem einsamen Hexameter dekliniert, im Sonett und in einem durchaus auf seine Reimkraft hin („Gott“ auf „Schafott“) mutig zu nennenden Titeltrack des ersten Teils: „Wirwiren mutieren“. Alles ist zu, das Weggesperrte verblasst hinter der Gardine; und selbst Rilkes Venedig dräut (beides im Sonett zuvor) spätestens seit Thomas Mann als Dunkelort.
Im wohl sperrigsten Zyklus des Bandes, der sich mit der „Stacheldrahtsprache“ der Jetztzeit befasst, zeigt sich Dove als ausgemachter Seismograf – spannt das Reden vom unterkühlten Dummschwätz der Börsenprimaten, lotet zugleich in die Tiefen dessen, was an klassischer Lautung durch das Flirren der LED-Äther dringt, und stachelt wirklich bis zur Klirrhärte der Maschinensprache auf, wirbelt die Textstimmen ineinander. Das Gewirr und Gewisper, das sich gern aus den Troll-Ecken in die Welt ergießt, mündet in ‚aleatorische Ghaselen‘: Kühl und in Teilen skurril mutet die streng am Wiederholungsreim hangelnde Form, die es im Nahen Osten zu hoher Blüte brachte, an, ins Deutsche gebracht; sie zeigt, Ghaselisch ist zwischen dem Auf- und Zuklappen der Reime, die anfangs paarig vorgeführt werden, und dem Hallen der verwaisten Zeile dazwischen nachgerade eine ideale, weil letztlich unendlich füllbare Form. Am eindrücklichsten im Gedicht „Eloquenz“, das streng genommen formal gar nicht ‚gilt‘ – denn dort sind die Reime ausgerutscht und umspielen sich irgendwann nur noch, um sich am Ende des Sprechens wieder einzukriegen. Auch Slang kommt darin vor, und es ergibt sich in diesem Tasten zwischen alter und neuer Lautung ein eigentümlicher Glanz.
Es ist dies sowieso ein Signet des Dove’schen Schreibens – von der Textur einer Oberfläche hinabzutauchen und sich, bei aller Schnoddrigkeit und Angecooltheit, ausgewiesen als Kenner der Materie zu zeigen. Aufs Klopstock-Jahr bezogen, vollführt er gewissermaßen den Bruch mit der bewältigten Form, ohne auf sie wiederum verzichten zu können. Es ergibt sich daraus eine seltsame Melange, die in der Tat etwas davon hat, etwas nicht zu Bewältigendes aufzubrechen und aus seinem Innenleben weiter etwas Neues zu bauen, das den Duft des Alten wie den Hautgout des noch zu Findenden gleichsam in sich trägt. Im Fall Doves ist’s auch ein halbbewusstes Registrieren, dass eine Epoche an ihre Kante gerät – ihre Umstände, die wiederum mit Weinliedern gelindert werden müssen, schönen und schunkelnden Epopöen, die bei einem verdrießlichen Ganymed landen und am Ende um die Liedgöttin Amy Winehouse trauern, deren Stimme nur blieb.
An den Rändern des Geschehens ist das, von wo man das Darunterliegende sieht und ergreift und aus der Tiefe (oder dem Kanon) in die Gegenwart holt. Fleißiger Ernst ist das, und ist auch ein Abgleich, was verloren ist, hinzugetan sein kann, vielleicht auch unverlierbar sich zeigt. Klopstock zum Beispiel. Und ist gleichzeitig ein Spiel. Im Fortgang „haideggert“ [sic!] es und dreht sich um Lieder, die „jenseits der Menschen“ zu singen wären – auch hier die kristalline Ambivalenz des kreisförmig wieder aufschließenden und als schrecklich zu bezeichnenden letzten Jahrhunderts, eben auch in Celan’scher Reminiszenz und Zurechtweisung der rülpsaffinen Großköpfe und Untersteller, die – man muss verhindern, es darauf ankommen zu lassen – einen Celan wieder bürokratisch korrekt ans Messer liefern würden. Oder philosophisch holzweggenau. Eine Zeit ist diese, in der „Shit“ für „Shiva“ verkauft wird, das Elend als Ablass für die Verheißung. Auch das uralt. Und da. In uns. Um uns. In der Zeit, der diese Gedichte gewidmet sind und noch zwei Runden drehen, lotend, auch serielle Muster mitnehmend … – die „Zeit anhalten(d)“.
Um wo sich wiederzufinden? Nun, auf den „Türmen des Windes“, nach wie vor, die nur dem Anschein nach für Ausblicke gebaut sind. Und auch sie liegen zerstückt, siehe Palmyra. Oder an den Rändern der Flüsse, in die unsere Reste gekehrt sind: „Mögen sie so/ dem Rad der Wiedergeburten/ entkommen.“ Das ist nun die Desillusion, die in der Zeit liegt. Was hilft? Was rettet? Seit jeher die Kunst. Und der Blick zu denen, die es vorgelebt haben. Zu Klopstock, zum Beispiel. Das tut Dove in seinem Schluss- und Titeltext, hexameternd, die Großen und Nachgänger aufrufend, sich in Bewunderung gebend, wie der Messias-Dichter es wagte, die Fernen und schier Unerreichbaren, nun, anzurufen. Es in ein ‚irdisches Vergnügen‘ nehmend zugleich im Angesicht des Lichts und – der Liebe. Die zeitig vergeht, ein tragisches Signum der Epoche. Und doch explizit vorhanden, in Oden und archilochische Verse (erstere tauchen auch hier auf) gefasst, ist und bleibt: „Weine nicht, Cidli.“ Nur so wissen wir davon. Und die sich, Licht und Liebe, donnernd und pathetisch in Popschmelz ergießen, wie der Autor an den Schlager-Gothics der Band Unheilig erkennt. Womit Klopstock, der Belächelte und hinter den Brägen der anderen gern Vergessene, bis in die Befundlagen der Gegenwart sichtbar flaniert. Klopstock als Heutiger – nun, dies ist ein equilibristischer Reiz.
Und ist vielleicht die einzige große Fallhöhe im Buch. Denn an einer 300-Jahr-Feier für Unheilig darf, ganz anders als im Falle F. G. Klopstocks, jetzt schon gezweifelt werden. Was vielleicht der Grund sein mag, dass der Meister auf der anderen Seite der Leitung nicht rangegangen ist. Und damit sein feines Lächeln im Netzwerk der Größe behält, flugs die Cidli-Verse über sein Bardengeraun, das auch ihm unterlief, schiebend. Richard Dove weiß es, benennt es am Ende dieses Buches, das mit der Ära ringt. Wo die Ewigkeit den Hörer liegenlässt gegenüber dem Jetzt, das sich: noch bewähren muss.
Richard Dove: Bei Anruf Klopstock. Zeitgedichte. Rimbaud Verlag, Aachen 2024, 115 S., br., 30,– €.