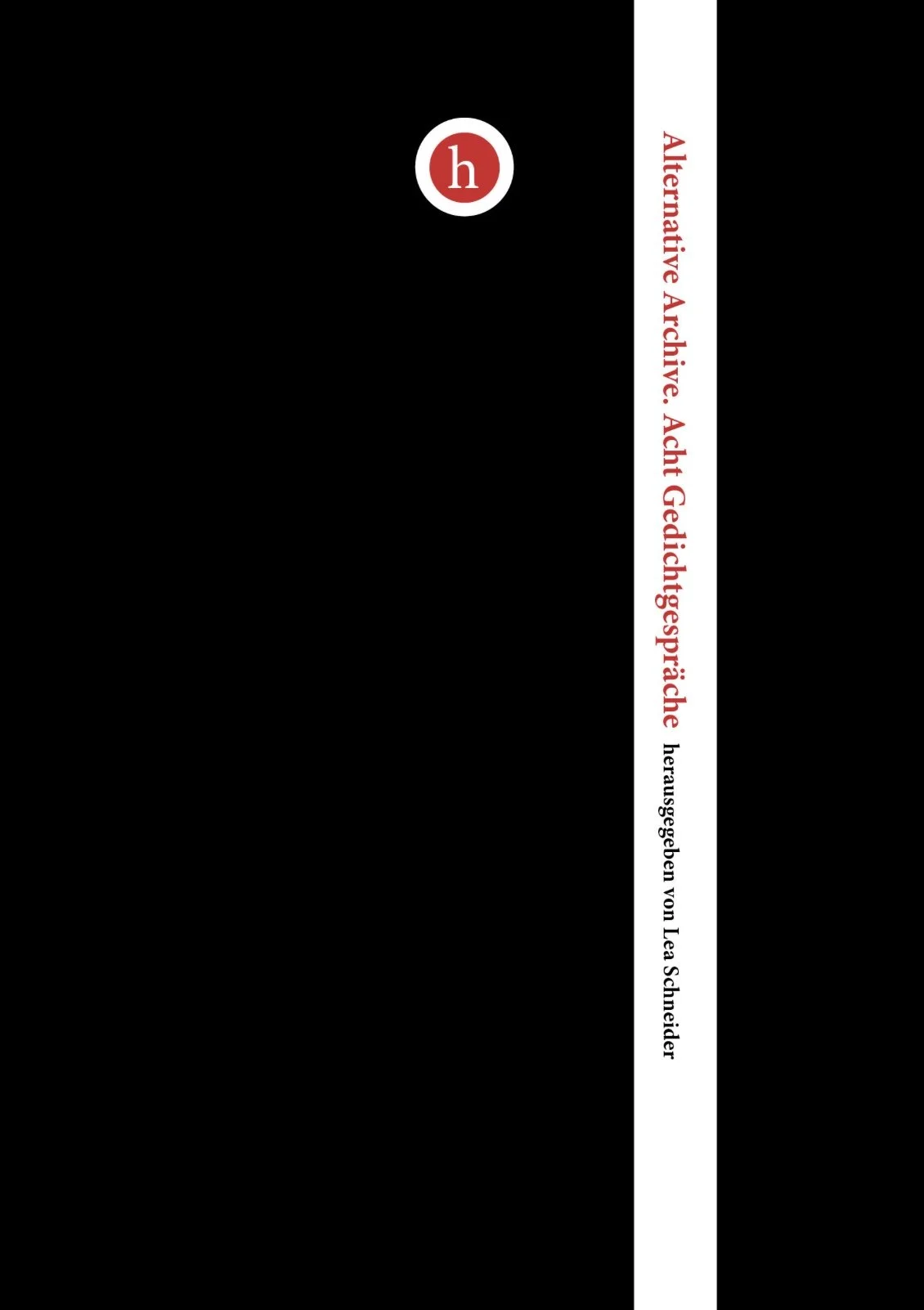Auf der Suche nach einer seismographischen Sprache oder: Das Leben als poetisches Geflecht
Zu Janin Wölkes unendlicher move
Wie ein sich stetig vollziehender Geburtsprozess entfaltet sich das Langgedicht unendlicher move von Janin Wölke über 160 Seiten, das im Februar 2025 im Elif-Verlag erschienen ist. Die „eskalierende Wahrnehmungsübung“, wie es auf der Verlagsseite des Elif Verlags heißt, ist im Juli schon in die zweite Auflage gegangen. Für einen Lyrikband ein großer Erfolg.
unendlicher move bedeutet:
sich auf eine Reise in ein System individuell verzweigter Erinnerungs- und Sprachstrukturen zu begeben, sich an Wortkristallisationen entlangzutasten. Als ein nicht-hierarchisches Nebeneinander schieben sich Zeitebenen und Stimmen einer Familie aus der Perspektive der Ich-Sprecherin, der Frau, die auch Mutter, Partnerin, Freundin, Schriftstellerin und Schwester ist, simultan ineinander und zeigen, dass kein Alltag und auch kein Leben rein linear verläuft, sondern ein poetisches Geflecht bildet. Biografie und Gedicht sind in Form dieses experimentellen Schreibprozesses miteinander verbunden.
Durch sich widerholende und variierende Sprachbilder der alltäglichen Gegenstände und Motive entstehen lyrische Kulminationspunkte aus sich überlagernden bzw. überlappenden Bildern, die etwas Magisches erhalten und weite Strecken des Gedichts miteinander verbinden, sodass gerade durch dieses Verfahren die aufgerufenen Artefakte mit Bedeutung aufgeladen werden. Die Nähe zur Magie der Sprache ergibt sich hier somit im Benjaminschen Sinne nicht durch einen mimetischen Gebrauch der Sprache, sondern in der Erfahrung eines „Dritten“, das sich unmittelbar durch dieses Geflecht mitteilt. Durch Wiederaufnahme und Variation entstehen semantische Aufschüttungen wie Sedimentablagerungen in einem Flussbett. Die Metapher des Flusses ist nur eine von vielen metasprachlichen Beschreibungen für das Langgedicht, die im Text selbst genannt und ausgestaltet werden.
Die Zitate von Franz Kafka und David Bowie am Beginn des Buchs erscheinen wie Teaser oder Wegweiser, die von Beginn an auch auf die Sprachreflexion des folgenden Langgedichts hinweisen, da innerhalb des Schreibprozesses, der als move bezeichnet wird, dessen „Machart“ immer wieder thematisiert wird. Die eingangs zitierte Betrachtung „Die Bäume“ von Kafka referiert auf die als „scheinbar“ bezeichneten Eindrücke der visuellen Wahrnehmung, die auf mehreren Ebenen unsicher sind. Der sprachreflexive Hinweis auf Kafka bezieht sich bei Wölke wohl auf das Verhältnis von Text und Weißraum, der in Kafkas Betrachtung im Bild der Bäume im Schnee schon aufgerufen ist. So verweisen sie nicht zuletzt auf die Buchstaben selbst, die sich auf dem Weiß des Schnees, der Seite, befinden. In unendlicher move wird ebenfalls mit dem Weißraum der Buchseite bezüglich der Textanordnung experimentiert, und auch hier werden Wahrnehmungen abgetastet und prüfend reflektiert.
Die sich durch ihre Suchbewegung, aber auch ihre Anziehung und ihren Sog selbst weitertreibende Sprache stellt sich transparent von Anfang an die Frage nach sich selbst, nach dem Vermögen, ein Medium von Erinnerung zu sein und wie dieses prozessuale Schreiben überhaupt an ein Ende kommen könne. Kafka beschrieb den Schreibprozess, der sich der Sprache experimentierend überlässt, als Schreiben in einen dunklen Tunnel hinein. Die Abfassung von „Das Urteil“ in diesem Schreibmodus nannte er überdies einen „Geburtsprozess“ – sowohl in Bezug auf die Entstehung des Textes selbst als auch auf das mit diesem Text verbundene Selbstverständnis als Schriftsteller.
Dass sich das Langgedicht, um die Wahrnehmungsmodalitäten auszuloten, auf die Spuren der Phänomenologie begibt, wird spätestens in den Endnoten des Bandes deutlich, die häufig auf die Textsammlung Phänomenologie der Lebenswelt von Edmund Husserl verweisen, aus der Passagen und Begriffe übernommen werden. Dennoch wirkt diese Intertextualität nicht akademisiert, sondern geht eine Verbindung mit dem konsequenten Abtasten der eigenen Lebenswelt ein. Hilfreich ist auch, dass der Lesefluss nicht durch Fußnoten unterbrochen wird, sondern Wörter und Passagen am Ende des Gedichts einzeln aufgeführt und erläutert bzw. nachgewiesen werden.
Zudem werden Songtexte von David Bowie, Nirvana, R.E.M. bis Elvis Presley zitiert, aber auch Ein-Wort-Zitate wie „lebenleer“ von Hugo von Hofmannsthal oder Passagen aus Georg Büchners Woyzeck kommen vor. Auf der Textebene werden damit Lese- und Hörerfahrungen aus der eigenen „Lebenswelt“ als individueller Soundteppich zu aktuellen und prägenden Ereignissen der Jahre 2021 und 2022 wie der Pandemie und der Flut im Ahrtal in Beziehung gesetzt. All diese Eindrücke sammeln sich auf besondere Weise im Gedicht an.
Zwischen Roland Barthes, Edmund Husserl und dem Rhizom, einer zentralen Metapher poststrukturalistischer Theorie von Gilles Deleuze und Félix Guattari, die in unendlicher move in Form des Myzels, des Pilzgeflechts, in ihrer nicht-hierarchischen, flächigen Struktur aufgerufen wird, tastet sich das Gedicht durch die Wahrnehmungsmodalitäten und Theoreme von Moderne und Postmoderne und nimmt sie auf.
unendlicher move ist in sechs nummerierte Teilzyklen gegliedert, die formal und inhaltlich durch die Biografie der Dichterin miteinander verbunden sind. Der Weißraum, der sich gerade zu Beginn eines neuen Zyklus auftut, lässt genug Raum für die stetige Frage nach dem Beschreibbaren und nach unserem fragilen Erinnerungsvermögen. Der dritte Teilzyklus beginnt mit gleich mehreren dieser Sätze, denen Raum gelassen wird, sich zu setzen und in Leseschritten allmählich zu verankern:
Wie könnte ich über all das sprechen.
Über Wunden sprechen.
Sprechen.
Fortgeschriebene Traumata
Bedrückend wird es an denjenigen Stellen, die innerhalb der alltäglichen Erfahrungen in der Lebenswelt der lyrischen Sprecherin Gewalt gegenüber Kindern thematisieren und zeigen, wie weitergetragene Gewalt Traumata aktualisiert.
hinterm Haus
sind nachts Dinge
sitzt jemand auf dem Hof
redet wütend
schreit eine Frau
sehe ich Balkone Dächer Rahmen
höre die Stimme der Schreienden aus dem Fenstergedränge
sie verwendet Kraft
um die Lautstärke zu halten
ein Kind weint
halt jetzt die Fresse
lass mich zufrieden
es ist klein
ich höre es am Ton des Schluchzens
es weint lang
die Frau schreit wieder
es hallt schrecklich über die Höfe
bis
ich du er sie es
wir
ihr auch
sie
alles liegt beieinander
tragen Trauma und fügen
das Kind wimmert leiser
wimmert etwas
die Frau brüllt
[…]
wie kann ich das sprechen
trösten
schützen
Mit dieser konkreten Passage, in der verbale Gewalt einem Kind gegenüber beschrieben und beobachtet wird, nimmt das lyrische Ich sich und auch uns als Leserschaft durch die Frage nach Interventionsmöglichkeiten mit in die Verantwortung.
Der Wechsel von konkreten Szenen und Überlegungen zu Lebenswelt, zu Gegenwart und Erinnerung vollzieht sich unmittelbar, wenn es nach dieser Passage abstrahierend heißt:
und Gegenwart ist ein Grenzpunkt
und Trennung des Gewebszusammenhangs
Ein Halm.
ein Fädchen
Die Szene, die mit Begriffen Husserls durchsetzt ist, indiziert ein Zeitkonzept, das die Gegenwart als Grenze und Grenzüberschreitung versteht – dabei kann es sich auch als Wunde und weitergegebene Gewalt zeigen. Gleichzeitig wird die Frage gestellt, wie sich Traumatisierungen sprachlich überhaupt ausdrücken lassen. Die sich selbst befragende Sprache als „Halm“ und „Fädchen“ zeigt sich als etwas Fragiles, aber auch Tröstendes, Schützendes. Gegen Heiner Müllers zitierte Aussage, „du musst einverstanden sein/ mit der Gewalt/ mit der Grausamkeit/ damit du sie beschreiben kannst“, stellt sich das Gedicht ganz entschieden; auch wird Sprache nicht als Messer, sondern als zärtlich, selbst verwundet und beschützend entworfen. Diese andere, womöglich weibliche Sprachverwendung, ein Wie der Sprache, wird als Möglichkeit der Heilung gedacht.
Immer wieder wird innerhalb der Lebenswelt von Wölke auf die Natur referiert. Die Naturmotivik, die sich durch den gesamten Band zieht und sich vor allem an Getreide, Wind, Gewässer (Nässe), Rinde und Myzel (Pilzgeflechten) zeigt, macht wiederum den sich im Gedicht mehrfach vollziehenden Übergang von ganz konkreten Wahrnehmungen in der Natur hin zu sprachreflexiver Naturmetaphorik spürbar.
An wenigen Stellen gibt sich das Gedicht ein wenig zu sehr dem Erklären seiner selbst hin, wenn es etwa heißt:
ich spreche also
über Wunden
mein Käfig ist das Schreiben
das Beobachten der Gleichzeitigkeit
die Wahrnehmung in Zeitlupe
ich schreibe Wunden
Dagegen wirken Passagen, die mit Variation und Wiederholung konkreter Motive spielen, besonders stark. Es zieht sich z.B. der Zucker, der auf der Hochzeit der Schwester zu Anfang verschüttet wurde, als Spur durch das Gedicht, genau wie Turnschuhe, Kugelschreiberminen, Pflaumen, Kinderspielsachen, das verlorene und verwandelt wieder auftauchende „Auge des Ra“, der Mann im weißen T-Shirt, nasse Kleidung, nasses Gras, die Heublumen, der Himmel, der Stern. Dies sind Stellen, die scheinbar Verlorenes wieder hervorholen, es fortsetzen, sodass Simultanität in linearen Verläufen wahrnehmbar gemacht und nicht nur behauptet wird. Zuweilen kulminiert das Verweben aus Gegenwart und Erinnerung des Erlebens und Schreibens in Passagen wie diesen:
die gelbe Wasserrutsche des Freibades
auch dass im Sommer die Mini-Tiere
wie weggeworfene Gegenstände aussehen
dunkler Turnschuh auf Wiese
Basecap am Wegrand
ein erdiger Geruch
der unten wärmt und oben Vögeln nachschaut
empfängt den rennenden Körper im Wald
meine uralten Nikes
[…]
bei Rennen
fallen meine Haare auf die Schultern
wie der Zucker
den ich verschütte
am Anfang des Gedichtes
Diese Collage verweist explizit auf ihren Beginn zurück und wächst so an sich selbst. So heißt es nämlich zu Beginn des I. Zyklus: „das Weizenfeld hinter meinem blauen Rock/ der Zucker den ich versehentlich auf dem Tisch/ hinter der Eisenbahnstraße verschütte“.
Je häufiger wir Leserïnnen im Langgedicht zwischen den genannten Kulminationspunkten der Bilder hin- und herspringen, desto deutlicher wird, dass eben jene Punkte das Langgedicht zusammenhalten und gleichzeitig auf Husserls Konzept von Zeit und Lebenswelt antworten.
Sprache als Muttersprache
Wölkes Langgedicht ist auch der Entwurf einer Muttersprache, einer Sprache des Kümmerns, des Wiedergutmachen-Wollens, der Hoffnung auf Heilung. Es wird gezeigt, wie diese „Zaubersprache“ in die Realität der Sandkastenkämpfe, der Gewalt, die Kinder sich gegenseitig antun und die Erwachsene aufgrund von Traumatisierungen und Sorgen den Kindern antun, hineinwirkt. Gerade der Fokus auf das Kind und seine Bedürfnisse und Wahrnehmungen, sein Spiel und seinen Spracherwerb auch in Form des magischen Denkens markiert die zentrale Motivik dieses Schreibens. Dabei geht es darum, die sich freilegenden Schichten des Lebens mitzuvollziehen und dabei die eigene Lebenswelt und Sprache als Praxis zu reflektieren.
Das Gedicht kann als große Collage bezeichnet werden, dessen lyrische Qualität in der Zusammenschau größerer Einheiten sichtbar wird. Es öffnet sich dem Prosaischen, dem Zeitverlauf, dem Alltag und gewinnt durch die Kraft der Bilder, die in ihm variiert wiederkehren, seine lyrische Konzentration.
die schwankenden Bäume hinterm Strand
ein maßloses Rauschen
ein sich drehendes Riesenrad unter dem wir warten
Das auf dem Cover abgebildete Riesenrad, das erst zum Ende des Langgedichts auftaucht, wird hier zum Sinnbild, mit dem Wölke das im Titel benannte Paradigma ihres Sprechens fasst: eine unendliche Bewegung.
Was macht die Modalitäten eines Lebens aus? Was ist Erinnerung? Wird aus diesen Bildern, Dialogen und Begebenheiten etwas „Festes“, an dem man sich entlanghangeln kann? In einem experimentellen poetischen Gewebe, das sich immer wieder selbst bis zu scheinbaren Kristallisationspunkten hin variiert, kann dieses „Feste“, nach dem das Gedicht selber fragt, nur vorübergehend im Prozess des Schreibens entstehen, das das eigene Leben mit seinen komplexen Überlagerungen verschiedener Bilder, Stimmen und Erinnerungen seismographisch dokumentiert, sich so an die Wirklichkeit eines Lebens täglich heranschreibt und immer wieder fluide wird.
Im Bild des Riesenrads schließt sich gerade kein Kreis, sondern es wird noch einmal offenbar, dass die Bewegung in Zeit und Raum bzw. in der Lebenswelt nicht aufhört und ein Lebenslauf keine lineare Bahn zeichnet. Janin Wölkes Langgedicht, das sich dieser Lebenswirklichkeit verpflichtet hat, findet eine Sprache dafür, aus der Folgerichtigkeit in fortgesetzter Bewegung ins Unabgeschlossene auszubrechen und dennoch einer Chronologie verpflichtet zu bleiben. Dies ist kein Widerspruch, sondern gestaltet die doppelte Bewegung eines Zeitempfindens von den Grenzpunkten aus.
Janin Wölke: unendlicher move. Gedichte. Elif Verlag, Nettetal 2025. 160 S., 20, – €.