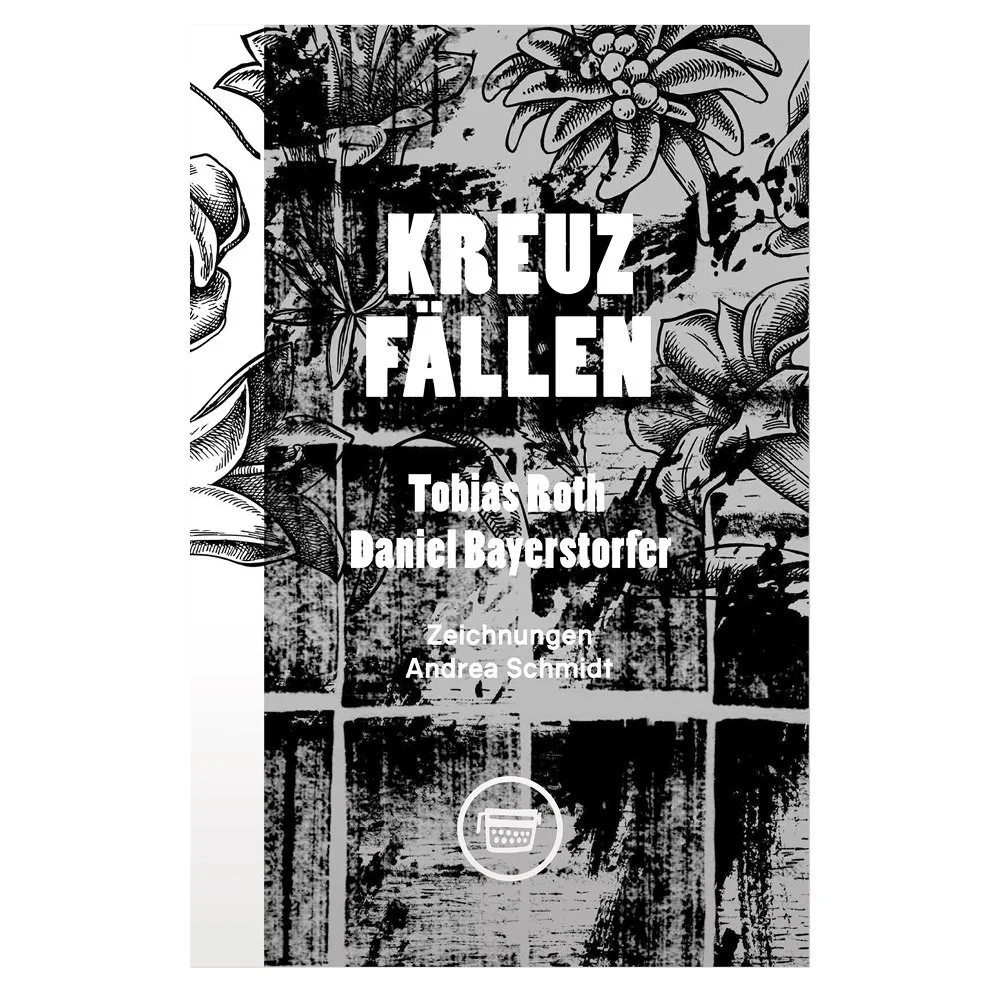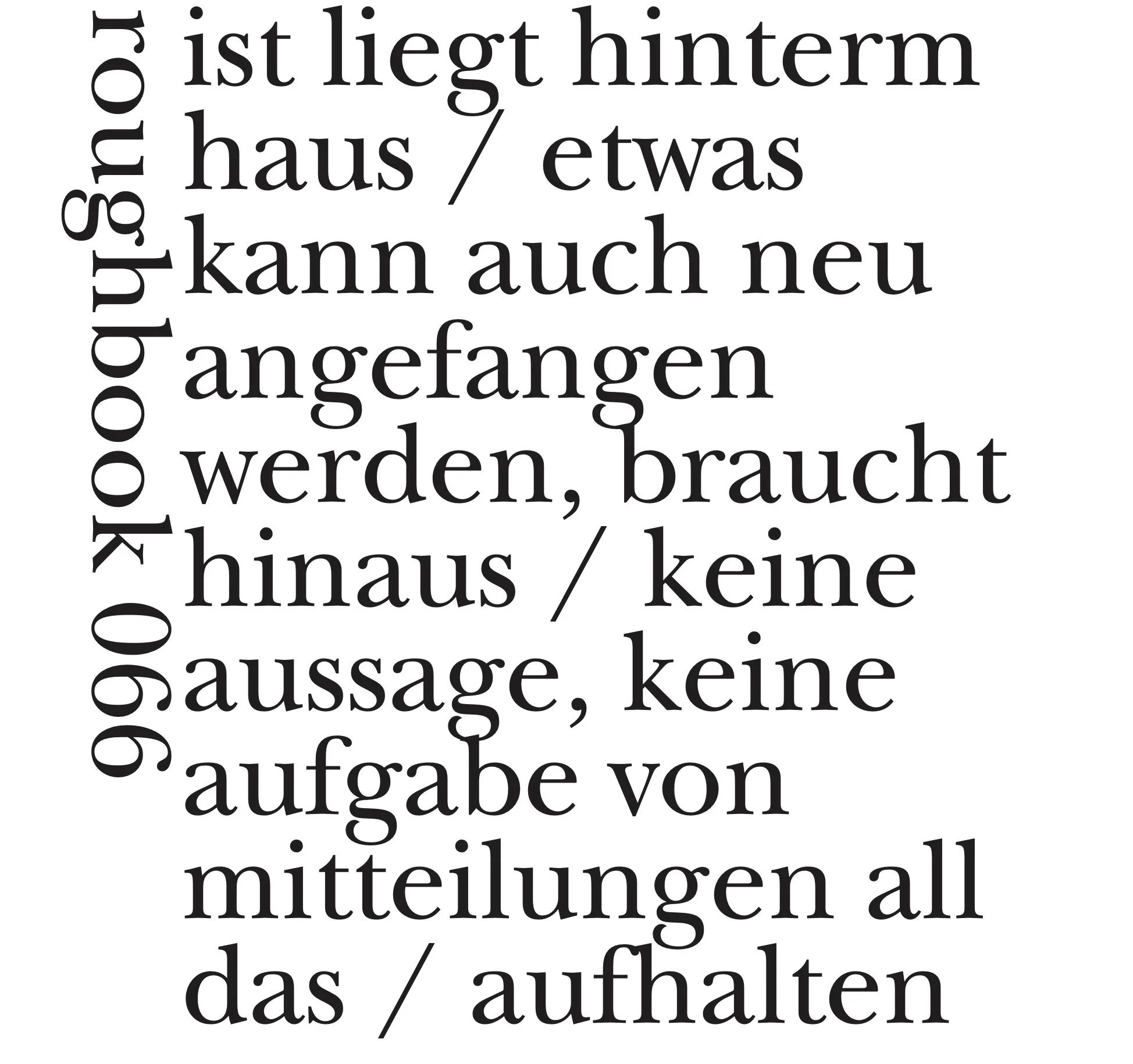Zwischen Jammertal und Jubelbergen. Tobias Roth und Daniel Bayerstorfer und ihr Langgedicht Kreuzfällen
Was für ein bizarrer Ton. Tobias Roths und Daniel Bayerstorfers Kreuzfällen ist um keine noch so gewagte Metapher und kein noch so fragwürdiges Bild verlegen. Mal erhaben, mal derb, schrill und wortverdreherisch – durchweg gelehrt und frech, ironisch im Umgang mit den metaphysischen Gewichten, die der gemeinsam verfasste Text stemmt. Ein Tanz der Sprachregister, der zudem Ausfallschritte ins Lateinische, Italienische, Französische und Mittelhochdeutsche, vor allem aber in ein genüsslich münchnerndes Bayrisch unternimmt, das „sentimentalischen“ Dummglotzern den Kampf ansagt, „bis eahna des Schrdoh beim Kohbf aussaschaut“.
Was für eine ausufernde Form. Wer sich dieses vergnügliche, aber nachschlageintensive Poem vornimmt, kann getrost bei der Gattungsbezeichnung anfangen. Als Epyllion – kleines Epos – wäre es eigentlich dem Hexameter verpflichtet, schert sich bei allem Sinn fürs Rhythmische aber wenig um das Metrum. Dienst nach Vorschrift leistet es eher im Parodistischen, für das der fälschlicherweise Homer zugeschriebene Froschmäusekrieg aus späthellenistischer Zeit das berühmteste Beispiel abgibt.
Nur was wird parodiert? Neben zahlreichen ehrwürdigen Dichterzitaten wird wohl auch die Form des Epyllions selbst auf die Schippe genommen. Jenseits der augenzwinkernden Bildungshuberei, die Roth und Bayerstorfer betreiben, ist es ihre Variante des heutzutage mannigfach bewirtschafteten Langgedichts. Walter Höllerer, der 1965 in der Zeitschrift Akzente das deutschsprachige Manifest des schwer einhegbaren Genres formulierte, ergänzte einige Jahre später zu Recht, er meine nicht den Gegensatz, „hier ein Gedicht mit zahlreichen Zeilen, dort eins mit wenigen. Vielmehr wurde einem Gedicht die Sympathie erklärt, das nicht noch mehr in immer gewähltere oder immer abgestumpftere Metaphern gerät, in noch engeren Chiffren verkürzt wird; einem Gedicht, das für einen breiteren Sprachstrom offen ist“. Dem könnte das Autorenpaar vorbehaltlos zustimmen.
Was schließlich für ein befremdlicher Stoff. „Seit Mitte der 1790er Jahre“, verrät ein vorangestellter Programmsatz, „werden jedes Jahr Dutzende Gipfelkreuze gefällt. Das ist ihre Geschichte.“ Das Thema ist alles andere als weit hergeholt. Der Vandalismus gegenüber Gipfelkreuzen hat gerade im vergangenen Jahrzehnt stark zugenommen. Sowohl im Tölzer wie im Salzburger Land, im Allgäu wie im Wallis haben Unbekannte aus antireligiösen Affekten heraus Gipfelkreuze verschmutzt, beschädigt oder zerstört.
Tatsächlich gibt es einen Dissens, ob Berge dieses Symbol überhaupt brauchen. Während etwa Reinhold Messner insbesondere die Errichtung neuer Kreuze mit Argwohn betrachtet, verteidigt sie die katholische Kirche vehement: Auch Ungläubige sollen an einen möglichen Wohnsitz Gottes erinnert werden. Der Appenzeller Künstler Christian Meier suchte 2016 die Provokation und errichtete auf dem Alpstein kurzzeitig einen drei Meter hohen Halbmond aus Acryl. Der Band erwähnt den Fall im Vorübergehen, erklärt ihn aber nicht weiter. Die Marginalspalte im Fettdruck steuert zu einigen wenigen Details Information bei, setzt in der Regel aber nur Zusatzakzente.
Kreuzfällen bringt sonst unversöhnliche Welten, Klangfarben und Figuren zusammen. Im Begriff des Gipfels begegnet das handgreiflich Alpine dem theoretisch Hochfliegenden. „Denn Schwerkraft ist ein Risiko, das man eingehen muss,/ generell neigt sich alles und neigen alle, Bäume wie Berge,/ Gedanken auch, dazu, sich nach oben hin zu/ verjüngen, hin Richtung Ast, Gipfel oder Prinzip,/ ein Kreuz ist da bloß das Einverständnis, dass man auch/ nicht weiter weiß, machma auch ein Kreuzerl in der Null,/ im O und der Pupille gehma im Kreis“.
Beim Kreuzbegriff hatten Roth und Bayerstorfer noch leichteres Spiel: „jedes Kreuz/ ist Ableitung von einem Gipfelkreuz, vom Original aus Golgatha“. Das religiös konnotierte Symbol des Leidens Christi und der Triumph des Bergsteigers sind seit Jahrhunderten Geschwister. Das 1800 auf dem österreichischen Großglockner errichtete Kreuz gilt als das erste seiner Art und wurde 1880 anlässlich des 25-jährigen Ehejubiläums von Kaiser Franz Joseph I. und Kaiserin Elisabeth von Österreich gegen ein drei Meter hohes und 300 Kilo schweres eisernes Kreuz ausgetauscht.
Wer allerdings die blasphemischen Gesellen sind, die hier „im Grünspan zu Berge“ ziehen, „fállerá!“, und im Schutz der Dunkelheit ihr böses Werk verrichten („Kreuzfäller Nächte sind lang“), bleibt, sosehr sich ihnen die Textstimme annähert, im Ungewissen. In ritornellartig wiederkehrenden, grammatisch nicht ganz korrekten Zeilen scheinen sie lediglich Ausführende einer Notwendigkeit zu sein: „Abend heißt der Herbst am Holz,/ es röten sich die Sägeblätter./ Ihr Rauschen stoppt nicht, schmolz/ und beugt sich das Gipfelkreuz;/ es steht nicht, es wurde gestellt,/ es fiel nicht, es werde gefällt.“
Prominenter tritt ein preußischer Adliger namens Johann Baptist Hermann Maria Baron de Cloots in Erscheinung, den sich schon Joseph Beuys als Schutzgeist auserkoren hatte. Besser bekannt unter dem Namen Anarchasis Cloots, den sich der radikale, von Robespierre unter der Guillotine zum Schweigen gebrachte Hébertist während der Französischen Revolution im antichristlichen Affekt zulegte, wird er im unmittelbaren und im übertragenen Sinn zum Chefsäger stilisiert.
Eine weitere wichtige Figur ist der nach dem Ersten Weltkrieg von sozialistischen Ideen bewegte Architekt Bruno Taut. 1919 entwarf er in seinen Mappenwerken Alpine Architektur und Die Auflösung der Städte oder Die Erde – eine gute Wohnung oder auch: Der Weg zur Alpinen Architektur die Utopie bewohnbarer Gebirge. „Er will die höchste Alpenkette, vom Mont Blanc zum/ Monte Rosa, und auch die breiten Ebenen des Tessin vollkommen/ umgestalten, Glaspaläste in die Felsen bauen und Städte wie/ Kristall, ein kosmisches Gelände soll das werden, kolossal.“
In weniger bedeutenden, um nicht zu sagen absichtsvoll unbedeutenden Rollen geistern Franz Josef Strauß, Markus Söder und Papst Benedikt durch die Seiten. Das alles ist assoziativ einleuchtend vernäht und mit sarkastischen Spitzen versehen, wenn beim Auf und Ab zwischen „Jammertal“ und „Jubelbergen“, zwischen high und low, etwa der selbstgefällige Menschenschlag der Starnberger ein kollektives Verdammungsurteil erfährt: „Wenn schon/ die Gletscher sterben müssen, soll es den magern/ Menschensohn mit den Mammuts getal spülen,/ mit den Säbelzahntigern und Starnbergern, denen das/ Herz unter der Northface-Jacke nicht mehr schlägt.“
Zwischen forcierter Bildlichkeit und ironischer Abfederung findet „Kreuzfällen“ eine unverwechselbare Tonalität – auch wenn der Grat zwischen Riesengaudi und Studentenjux hauchdünn ist. Treffsicher erblüht der Berg im „A-Dur des Enzians, die Sedimente brummen de profundis weiter“. Auf allen Ebenen suchen Roth und Bayerstorfer die Zuspitzung bis zur Sentenz. „Steine sind in Schwerkraft verwandelte Schreie“, heißt es. Und „Gebirge, vom Weltraum zu Kugeln geschliffen,/ nennen wir Planeten, Gebirge, auf Hände und Köpfe,/ auf Finger und Kniekehlen reduziert, dagegen/ David oder Apollon von Belvedere, Medusa/ Rondanini oder den Kuss“.
Die Unentwirrbarkeit von Ernst und Unernst ist Voraussetzung dafür, die Fantasie so rauschhaft von der Kette zu lassen, dass in einem Atemzug „von satanisch invertierten Burschenvereinen, Ritualmord und besonderer Schwere der Wokeness“ die Rede sein kann und dann wieder die Suche nach einer climate poetry in den Vordergrund rückt, die der Verwüstung unserer Welt gerade im Komischen gerecht wird: „Irgendwo dahinten gibt es ein Hospiz/ für Gletscher, wo das Alpenglühn noch/ nicht hinreicht, das Rhizom der Sessellifte“.
Unnötige Selbstbespiegelung treibt dieses Epyllion nur, wo sich die beiden „süddeutschen Welterklärer/ auf Flügeln eigenen Gesanges“ in den „alpenfernen Bergmannkiez“ der deutschen Hauptstadt tragen lassen und vom Ausgehen nach einem Leseabend berichten, bei dem auch der Münchner Dichterspezi Tristan Marquardt mit von der Partie ist.
Roth, Jahrgang 1985, und Bayerstorfer, Jahrgang 1989, haben das Schreiben im Doppel, wie immer es praktisch vor sich geht, schon 2018 in einem ersten Epyllion namens Die Erfindung des Rußn (Aphaia Verlag) erprobt. Die Materialschichten aus Historischem rund um die Münchner Räterepublik, Mundartlichem und Folkloristischem wie dem titelgebenden Mixgetränk aus Weizenbier und Zitronenlimonade, besitzen aber längst nicht die Wucht von Kreuzfällen. Wenn die beiden ihre „Rußndialektik“ entwickeln, klingt es sehr nach bloßem Kneipenwitz: „,These: Bier.‘ (Er zieht am linken Ohr.) / ,Antithese: Limonade.‘ (Er zieht am rechten.) ,Und die Synthese dann: der Rausch.‘“
Eine nicht zu unterschätzende Qualität beider Epyllien liegt indes im Versuch, dem Mundartlichen in der Dichtung wieder eine Bühne zu geben, ohne es allein in humoristischer Absicht einzusetzen. Der Bruch mit der dominierenden Hochsprache, der Ortsunkundigen wie die Grobheit schlichter Gemüter anmuten kann, öffnet in Wahrheit den Weg zu einem unverblümten Sprechen, das in all seiner Blumigkeit eine zärtliche Genauigkeit entwickelt.