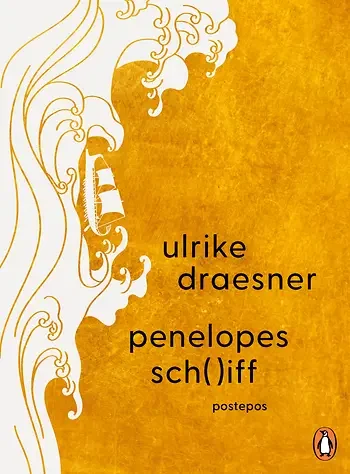Weird Poetry in Deutschland
Zu Alke Stachlers doch das ende war hell
H. P. Lovecrafts cosmic horror behauptet, das Projekt Menschheit ist verloren, weil es das schon immer war. Er ergänzt die drei bekannten Kränkungen der Menschheit, wie Freud sie formulierte: Der Mensch ist nicht der Mittelpunkt der Erde (Kopernikus), der Mensch ging aus dem Tier hervor (Darwin), der Mensch ist nicht Herr seiner Seele (Freud). Hinzu kommt bei Lovecraft: Der Mensch ist nur eine Durchgangsstation bis zur Rückkehr der ersten Wesen im Kosmos. In diese wundervoll düstre Welt entführt die 1984 geborene Autorin Alke Stachler mit ihrem nunmehr dritten und ausgesprochen lesenswerten Lyrikband doch das ende war hell, der diesen Sommer in der parasitenpresse erschienen ist. Das Interesse am Fantastischen, Vor- und Nachmenschlichen als dem innersten Kern der guten Gründe für die Verzweiflung hält diesen Band zusammen.
Der Titel – auch Titel des zweiten von zwei Kapiteln – täuscht. Helligkeit glänzt durch Abwesenheit. In einem Gedicht darin gibt es „ein gewicht, das auf dem körper hockte“, eine aus dem Schatten sprechende Person stellt die Frage, ob „blei überhaupt schwer ist“, und etwas, das auseinanderfällt „wie blumen, ein lichtschein“. Man darf an Johann Heinrich Füssli berühmtes Gemälde Nachtmahr denken, das einen Inkubus zeigt, der unter scharfer Beobachtung eines Albtraumpferds (night-mare) einer wehrlosen Frau schlimme Träume beschert, während eine seltsame Lichtquelle für Schatten sorgt. Verlorenheit steht im Zentrum von Stachlers Poetik.
Inneres und Äußeres werden gespiegelt. Die menschliche Existenz ist hinausgehalten ins Nichts, die großen Erfolgsversprechen des menschlichen Projekts wirken wenig vielversprechend. Wer in diesen Gedichten spricht, weiß über diese abgründige Doppelbotschaft gut Bescheid: „meeresrauschen sprach zu mir:/ heute wendet sich das blatt zum guten“. Was vom Gedicht konsequent unterlaufen wird. So auch ein zweiter Gedichtanfang: „es sah aus wie ein glitzern, aber es waren wesen/ und ja, der untergang war schön, fremd, verflixt, verzaubert“. Verse als ein pars pro toto des gesamten Buchs, die projizierte Stimmung in a nutshell. (Passenderweise ist mir bei einem weiteren Vers, der dieses Kriterium erfüllt, das Buch in die Badewanne gefallen. Das nennt man mal Affektpoetik.)
Die Gedichte diskutieren das Gefühl von Verlorenheit nicht einfach nur, geschickt wissen sie es zu evozieren. Man weiß nicht, wo man ist; wer man gerade ist; warum der Kopf dröhnt; warum man weint; wer einem auf den Fersen ist. Wie funktioniert das? Wie alle Gedichtbände, die mir gefallen, hat mich dieser Gedichtband poetologisch beschäftigt. In einem Text etwa gibt es ein Ich, das mit Blessuren aufwacht, sich selbst in der Außenansicht wahrnimmt, den Realitätsgehalt befragt. Das Gedicht ist kurz, die Abfolge der Ereignisse entkernt. Vorspiel und Auflösung fehlen. Verlorenheit überträgt sich, weil diese Szene, in der offenbar ein Schmerz realisiert wird, sich über das ganze Gedicht erstreckt und man durch diesen poetischen Move mit einem Schmerz konfrontiert wird, der das ganze Leben ausfüllt, vor dem nichts war und nach dem nichts kommt. Mehrfach entwirft Stachler Szenen der Dunkel-Epiphanie, des Untergangs, des Einbruchs des Realen, der Einsicht in die Unmöglichkeit des Entkommens. Wären wir im Film – im Horrorfilm, im Psychothriller, im genre-film-gesättigten Autorenkino –, wären das zentrale Szenen. Im Film aber kommt etwas vor diesen Szenen und etwas danach; sie sind eingerahmt. Der suspense steuert auf etwas hin, baut sich langsam auf. Das funktioniert im Gedicht aufgrund seiner Kürze anders. So fehlen hier oftmals Vorspiel und Auflösung. Wir steigen in medias res oder besser in medias crises ein.
Erstaunlich ist, dass die Gedichte auch ohne solche Rahmung nicht verlieren. Wir können Vorspiel und Auflösung mit unserem eigenen Erfahrungsschatz besetzen, mit unseren eigenen Bildern, mögen sie dem archetypisch organisierten Unbewussten oder der bis zur letzten Vorstellung ausgepressten Dauerkarte beim Fantasy Film Fest entspringen. Gleichwohl stellt diese Poetik eine Herausforderung für die Leserschaft dar. Als jemand, der in seiner Kindheit und Jugend im Kapitän des Raumschiffs Enterprise D (später auch E) Jean-Luc Picard einen Vaterersatz fand, ist mir „das wort traktorstrahl“ natürlich wohlbekannt. Wer einmal in diesen Bild- und Erfahrungsraum geworfen nur verdutzt vor den möglichen Weggabelungen steht und die Schilder am Wegesrand nicht lesen zu vermag, wird dagegen nicht abgeholt.
Bei vielen Gedichten funktioniert diese poetische Strategie Stachlers aber ganz ausgezeichnet. Und zwar gerade, wenn die Bilderreihe eine Folgerichtigkeit suggeriert, die es außerhalb des Gedichts nicht gibt. So träumt jemand von einer Hochzeit und einem Priester, der den Menschen als das schwache Wesen definiert; dann gibt es pronto eine starke Reaktion auf den Duft von Wein; ein Schwan geht auf das Ich los, so auch die Braut; allgemeines Schwanken, Zu-Boden-Gehen, Haut-Abschälen; ein kurzer Moment anlassloser Trauer – oder eine über die offenkundig misslungene Hochzeit? – und schließlich scheint da noch etwas im Raum zu flattern, das zuvor nicht erschien, aber schon immer da war. Bei anderen Gedichten ist – für mich – die Verlorenheit nicht evoziert, ich muss sie intellektuell herauskratzen, vielleicht auch nur, weil ich nicht über ein interessantes Arsenal an Assoziationen verfüge, die ich einsetzen kann. Oftmals sind es gerade die sehr kurzen Gedichte, die auch nach Mehrfachlesen eine undurchdringliche Härte beim Lesen entfalten.
Nachdenken musste ich auch, ob naturlyrische Semantik, die vom Abgrund spricht, Elliptik als Bauprinzip und Scifi-Vokabular zusammen nicht notgedrungen einen so kräftigen Cocktail ergeben, dass man jede Ingredienz einzeln herausschmeckt (und ob das etwas Wünschenswertes ist).
Aus mancher Ratlosigkeit rettet mich die bisweilen schöne akustische Arbeit der Gedichte, etwa wenn es heißt: „liebes liebesorgan/ lieber eisengesang/ ascendent saggitarius/ herz aus nebel, herz aus harz“. Und auch einzelne Verse, die mich mit ihrer Prägnanz und Enigmatik berührt und beschäftigt haben, etwa der Gedichtanfang „fragen, wie die frage war“. Ja, das ist wohl – ich spreche ironiefrei – ein Existenzial des Menschseins. Oder die Unmöglichkeit einer der vielen Selbstansprachen der Gedichte, die man erst beim dritten Lesen bemerkt: „geisterplanet, wann war die nacht, in der ich/ den verstand verlor“. Der verlorene Verstand verunmöglicht ja die Frage. Oder diese Selbstansprache, die so simpel wie im evozierten Echo berührend ist: „ich sprach zum sich zurückziehenden horizont/ du darfst traurig sein/ der sich zurückziehende horizont sprach zu mir/ du darfst traurig sein“.
Nachdem das heizungsgetrocknete Buch zugeschlagen war, fragte ich mich: Gibt es eigentlich schon so etwas wie eine Mini-Tradition der weird poetry in Deutschland? Georg Leß arbeitet in diesem Raum; nicht nur, aber in die Nacht der Hungerputten mit Vehemenz. In Andra Schwarz’ Tulpa durfte man starke Gedichte lesen, die sich Lynchs Twin Peaks aneigneten. Katia Sophia Ditzler spielt mit postapokalyptischer Spiritualität. Bei Titus Meyer finden sich Anspielungen auf den Horrorfilm; andernorts hier und dort Mensch-Tier-Fantastik, die Wiederbelebung untoter Tiere oder Tricksterfiguren, wie man sie in Kürze bei Stolterfohts rückkehr von krähe wird lesen dürfen. Das ist vielleicht alles zu disparat, um diese unterschiedlichen Einzelinteressen und Poetiken auf einen Begriff zu wenden; aber doch ist das Interesse am Unheimlichen, Abgründigen, Abweichenden eine logische Konsequenz aus einem der Zentralmomente der deutschsprachigen Lyrik der vergangenen 25 Jahre, nämlich der Erkundung von Bereichen, die poetische Intensität versprechen und gemeinhin anderen Gattungen – der Prosa, dem Essay, der Forschung – zugeschlagen sind, nun aber produktiv enteignet werden. Stachlers schöner Band, der auf eine schnelle Zugabe hoffen lässt, reiht sich da aufs Beste ein.