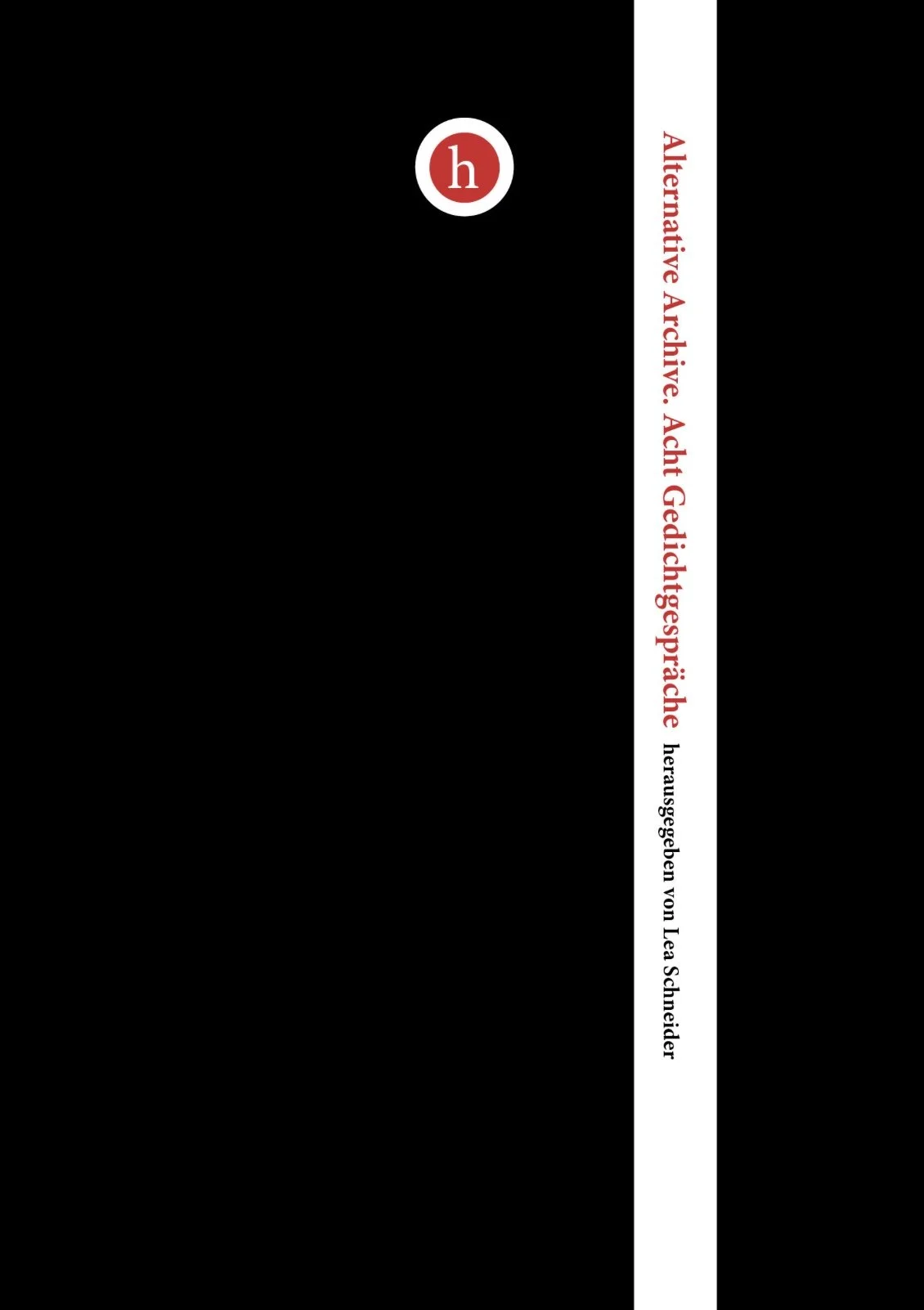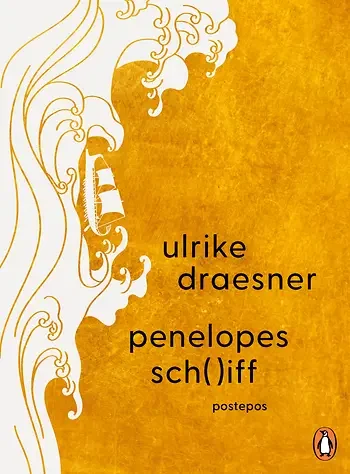Agi Mishol - Gedicht für den unvollkommenen Menschen
Kürzlich hörte ich wieder die Frage, was zeitgenössische Lyrik eigentlich ausmache – wo die Form doch so frei sei. Schließlich ist es mit gebundener Sprache längst nicht mehr getan. Vielleicht lässt sie sich mit Agi Mishols Gedicht für den unvollkommenen Menschen beantworten.
Die in Siebenbürgen geborene Tochter von Holocaust-Überlebenden zählt zu Israels bedeutendsten Lyrikerïnnen der Gegenwart. Bisher lagen auf Deutsch nur einzelne Gedichte in Anthologien vor, übersetzt von Lydia Böhmer. Nach mehr als fünfzig produktiven Jahren ist nun eine Auswahl in der Edition Lyrikkabinett erschienen – in enger Zusammenarbeit mit der Übersetzerin Anne Birkenhauer, was sich in den wohlbedachten Setzungen zeigt. Mit tiefem Wissen um das Gewicht der Worte eröffnet uns die deutsche Fassung Mishols Lebenslandschaften: mal in bodenständiger Kontemplation, mal mit gleichnishaftem Witz.
Man geht schlafen.
Der Wolf mit dem Schaf.
Man gewöhnt sich aneinander
so wie die Augen
ans Dunkel.
Mishols Fabelwelt bevölkern zahlreiche Tiere: Tauben, Pfaue, Hunde, in Alpakas verwandelte Literaturkritikerïnnen und in Ameisen verwandelte Lyrikerïnnen. Auch die Ursprünge der hebräischen Lyrik – ja des Hebräischen selbst – durchdringen ihre Poetologie. Das Heilige rückt sie dabei ganz nah an sich heran, macht es greifbar:
ich lese
ich mache Zeilen
ich berühre
und in diesen Momenten
bleibt Gott
lieber inkognito.
Mishol ist nicht nur eine Naturlyrikerin, wie Birkenhauer im Nachwort schreibt: Fernab des Urbanen und der nicht enden wollenden Gewaltexzesse scheint sie sich – umgeben von ihren Granatapfel-, Pekannuss- und Zitronenbäumen in der „Hütte am Waldrand“ wie in der Sprache – wohler zu fühlen als unter Menschen. So lauten die ersten Zeilen des Gedichts „Schutzraum“ vom Oktober 2023:
Jetzt wo rundherum Tod kriecht
und Pekannüsse sich in die Schale drücken
verstecke ich mich im Hebräischen.
Nichts wird mir geschehen beim arglosen Schreiben
Gleichermaßen ist ihre Lyrik getrieben von der Liebe zu jenem „unvollkommenen Menschen“, davon, „den horrenden horrenden Hunger nach Liebe/ den auch viel Kaffee nicht löschen kann“ – mit dem Wort, der Metapher, einer lapidaren Alltagsbeobachtung zu lindern, ihm jenen Schutzraum zu geben. In ihrem lakonischen Ton ist unschwer die Verwandtschaft zu dem von ihr geschätzten William Carlos Williams zu erkennen.
Widerständig und leichtfüßig kommen ihre Verse daher, um uns im nächsten Moment mit der ganzen Wucht des Seins zu treffen – oder vielmehr des Nichtseins, des Nichtmehrseins. Denn diese Gedichte sind ein Akt des Erinnerns, nicht des Gedenkens: an Vertrautes, Verlerntes und Vernichtetes. Vielleicht ist Verlust so zu (er-)tragen, „mit all den Wörtern die du/ für dich selbst erfinden musst/ an meiner statt“, heißt es in „Und meine Mutter fügt hinzu“.
Müsste ich also antworten, was die Gattung der Lyrik ausmacht, könnte ich es vielleicht mit diesen Beispielen tun – dem Eigentlichsten allen uneigentlichen Sprechens, den Wörtern, die immer wieder erst erfunden werden müssen, an Stelle dessen, was fehlt.
und bevor du aussteigst
musst du entscheiden, welchem Ende du glaubst.